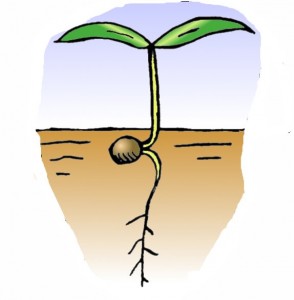Selektiv absorbierende Beschichtung für Solarkollektoren
26.09.2008 von michey
Selektiv beschichtete Absorber haben eine entscheidende Bedeutung für das Erreichen hoher Temperaturen im Solarkollektor. Ohne seine selektive Beschichtung würde ein Absorber einen erheblichen Teil der erzeugten Wärmeenergie in Form von Wärmestrahlung an seine Umgebung abstrahlen. Aus diesem Grund benötigt man einen Absorber, der das sichtbare Licht der Sonne möglichst gut absorbiert und in Wärme umwandelt, aber auch bei hohen Temperaturen möglichst wenig Wärmestrahlung aussendet. Schichten aus Schwarzchrom oder Titan-Nitrid-Oxid erfüllen solche Eigenschaften sehr gut. Normalerweise werden diese selektiven Schichten mit dem PVD Verfahren oder galvanischen Verfahren auf die zu beschichtenden Absorber aufgebracht. Die Investitionskosten für solche Beschichtungsanlagen sind aber relaitv hoch und lohnen sich nur bei großen Stückzahlen. Sollen selektiv beschichtete Absorber in regionalen Wirtschaftskreisläufen durch Kleinstunternehmen hergestellt werden, sind Verfahren notwendig, bei denen die Investitionskosten wesentlich niedriger sind.
In der Literatur findet man bei Blanke [9]; Seite 327 Stoffwerte für den Stahl 1.4301 bezüglich der Absorption und Emission von Strahlung in Abhängigkeit von der Wellenlänge der Strahlung. Daraus ergibt sich, dass die oxidierter Oberfläche von Stahl die Eigenschaften einer selektiv absorbierenden Schicht hat. Viele Stähle sind zu günstigen Preisen zu kaufen. Die Erzeugung einer dunklen Oxidschicht auf einer Stahloberfläche ist jedem Handwerker, der mit Stahl arbeitet unter dem Begriff „Anlassfarben“ bekannt. Die Herstellung einer Oxidschicht mit möglichst dunkelblauer Farbe ist relativ einfach – ein sehr gutes Beispiel für eine mittlere Technologie.
Um auf einem Stahlblech eine dunkelblaue Oxidschicht zu erzeugen, wird dieses erst gereinigt und dann möglichst gleichmäßig bei Anwesenheit von Luft auf eine Temperatur von 295 °C erwärmt. Danach ist die selektive Beschichtung fertig. Eine eigene Temperaturmessung des heißen Stahlblechs sofort nach dem Anlassvorgang mit einem Infrarot-Thermometer ergab laut Infrarot-Thermometer eine Temperatur von lediglich 73 °C. Mit der Hand war auch kaum Wärmestrahlung zu spüren. Beim Abkühlen unter fließendem Wasser war das laute Zischen des verdampfenden Wassers zu hören. Die Wassertropfen perlten, auf einem Dampffilm schwebend von der Metalloberfläche ab. Dass ist ein Zeichen dafür, dass die Temperatur des Stahlbleches weit über hundert 100 °C gelegen haben muss. Anhand dieser Beobachtung und der Messung mit dem Infrarot-Thermometer wird der selektive Charakter der Oxidschicht der dunkelblauen Stahloberfläche deutlich.
Bezüglich der Langzeitstabilität und dem Umgang mit dieser Beschichtung müssen noch Erfahrungswerte gewonnen werden. Auch die genauen Eigenschaften der erzeugten Oxidschicht müssen noch untersucht und recherchiert werden. Es gilt dabei zu beachten, dass die Oxidschicht vor Feuchtigkeit geschützt werden muss, was bei der Konstruktion des dazugehörigen Solar- Luftkollektors zu berücksichtigen ist.