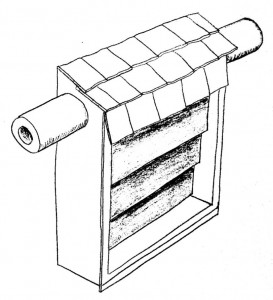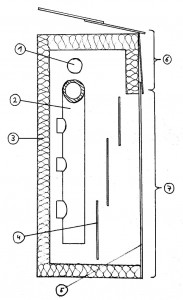Hintergrund der Idee
Als ich ein Kind war, war es in Deutschland mit etwas Ausdauer möglich, sich sich als Arbeiterfamilie gegen die Lehrer in den Hauptschulen durchzusetzen, und über den Weg der Realschule und über das Gymnasium zum Studium zu gelangen. Wenn man als Arbeiterkind zum Beispiel ein Studium des Maschinenwesens abgeschlossen hatte, war man Diplom-Ingenieur. Das war ein weltweit anerkannter Abschluss, der einen Menschen dazu befähigte, selbständig als Ingenieur zu arbeiten. Mit Fleiß Talent und Ausdauer konnte man also selbst als Arbeiterkind zu einem Universitätsabschluss gelangen.
Mit der Einführung von Studiuengebühren an den Universitäten und durch die Einführung der angelsächsichen Abschlüsse „Bachelor“ und „Master“ hat sich das grundlegend geändert. Ein junger Mensch, der eine Hochschule besuchen möchte muss als erstes die Hürde der Studiengebühren überwinden. Wenn er dies geschafft hat, kann er sein Studium mit dem „Bacherlor“ abschließen. Durch den Abschluß „Bacherlor“ gesteht man dem jungen Menschen zu, dass er in einer Firma seinen Vorgesetzten zuarbeiten kann. Selbständig als Ingenieur arbeiten dürfte ein Bachelor allerdings nicht, da er ja kein fertig ausgebildeter Ingenieur ist. Wenn der junge Mensch allerdings denkt, dass er, nur weil er jetzt Bachelor ist, weiter studieren darf, um den akademischen Grad des Masters zu erlangen, so täuscht er sich. Um Master werden zu dürfen, sind in vielen Hochschulen bestimmte Zugangsvoraussetzungen nötig, wie zum Beispiel ein guter Bacherlor-Abschluss. Hier wird die Trennung zwischen den sozialen Schichten wirksam.
Ein Student, der nicht neben dem Studium arbeiten gehen muss, um für seinen Lebensunterhalt zu sorgen, hat mehr Zeit, um für seine Prüfungen zu lernen und hat so eine höhere Chance, bessere Noten zu schreiben. Ein Student, der viel Geld zu Verfügung hat, kann sich auch Nachhilfestunden leisten und so seine Chancen auf einen guten Bachelor-Abschluss erhöhen.
Wer Doktor-Ingenieur werden möchte, der braucht ohnehin Beziehungen und da entscheidet vor allem die Herkunft des Studenten. Ich möchte hier nicht ausschließen, dass es in den Universitäten auch Professoren gibt, die aus Menschlichkeit heraus ihre Dokrotanden nicht nach sozialer Herkunft auswählen. Ich jedenfalls, habe die Auswahl nach sozialer Herkunft erleben müssen. Der Leiter meines Lehrstuhls hat mir damals persönlich ins Gesicht gesagt, dass ich nicht Promovieren könne, weil mir „das gewisse Etwas“ fehle. Ich denke, dass ich nicht der einzige bin, der solche Dinge erleben muss.
Keiner würde in einem demokratischen Land wie Deutschland zugeben, dass solche Zustände existieren und die Ausgrenzung von Menschen aus den unteren sozialen Schichten der Bevölkerung ist auch nicht gesetzlich verankert. Die Ausgrenzung der unteren sozialen Schichten findet hinter verschlossenen Türen statt. Es ist so wie wenn es eine gläserne Decke gibt, die einen Menschen am Aufsteigen hindert. Ich denke, dass es naiv wäre, auf Hilfe seitens der Politik zu erwarten, denn in der Politik sitzen nicht die Menschen der unteren sozialen Schichten.
Eine gute Ausbildung ist das einige, was den Menschen der unteren sozialen Schichten sowie der Mittelschicht helfen kann, im Leben zurecht zu kommen. Was können die Menschen der unteren sozialen Schichten also tun?
Die selbstorganisierende Universität
Es gibt eine Lehrmeisterin, die nicht unterscheidet, welcher Gesellschaftsschicht ein Mensch angehört und das ist die Natur selbst. Niemand kann einen Menschen daran hindern, die Natur zu beobachten und selbständig zu forschen und zu studieren. Das schöne an den Lehrsätzen, die in den naturwissenschaften formuliert werden ist, das die Versuche und Beobachtungen, die diesen Lehrsätzen zu Grunde liegen, für jedermann wiederholbar sein müssen. Durch Beobachtung besteht thoeretisch die Möglichkeit des Studiums. In der Praxis würde aber die Lebenszeit eines Menschen nicht ausreichen, um alle nötigen Kenntisse für ein Studium selbständig durch eigene Beobachtungen zu erlangen.
In Deutschland haben wir zur Zeit noch eine weitere Möglichkeit, an Ausbildung zu gelangen: Die Universitätsbibliotheken sind öffentlich zugänlich. Da die Öfffentlichkeit die Hochschulen durch Steuergelder finanziert, hat sie auch ein Recht darauf, Hochschulbibliotheken zu nutzen. Das gesamte Wissen, das ein Student in einer Hochschule benötigt, ist in den Büchern der Bibliotheken vorhanden. Wenn ein Student einen Lehrplan und eine Liste von Buchempfehlungen besitzt, dann kann er sich all die Theorie des Studiums selbst aneignen.
Wenn ein Mensch Ingenieur werden möchte, dann ist neben dem thoretischen Wissen ist auch ein praktisches Wissen erforderlich. Dieses praktische Wissen kann sich ein Mensch am besten während der praktischen Tätigkeit erarbeiten. Hier Möchte ich jetzt eine Idee beschreiben, die eigentlich bereits sehr alt ist. Ich möchte diese Idee aber etwas erweitern und an die heutigen Gegebenheiten anpassen.
Wie wäre es, wenn sich Ingenieursstudenten als Teil einer selbstorganisierenden Universität sehen? Wie wäre es, wenn die Studenten auf dieser selbstorganisierenden Universität ihr Wissen in Workshops von optimalen Unternehmen erwerben?
Studium in der selbstorganisierenden Universität
Das Studium in der selbstorganisierenden Universität würde sich aus vier Teilen zusammensetzen:
- Selbststudium der Fachliteratur
- Arbeit an Projekten in Workshops
- Anfertigen von wissenschaftlichen Arbeiten.
- Verteidigung vor einem selbstorganisierenden Prüfungskreis aus fünf Fachleuten mit Berufserfahrung im jeweiligen Fachbereich und einem Mindestalter von 35 Jahren.
Um an einer selbstorganisierenden Universität zu studieren sucht sich ein Mensch einen Mentor aus seinem Fachgebiet und spricht bei ihm vor. Der Mentor betreut den Ingenieursstudenten bis zur kommenden Prüfung und muss ein Mindestalter von 35 Jahren haben.
Akademische Grade
Die akademischen Grade einer selbstorganisierenden Universität könnten im Beispiel eines Ingenieursstudiums vielleicht wie folgt aussehen:
Ingenieursanwärter
Ein Ingenieursstudent an einer selbstorganisierenden Universität wird dann ein Ingenieursanwärter, wenn er in drei Workshops mitgearbeitet hat und dort drei Teilaufgaben eigenständig unter Aufsicht eines Betreuers erfolgreich abgeschlossen hat und für jede Teilaufgabe eine wissenschafltiche Arbeit verfasst hat. Diese wissenschaftlichen Arbeiten muss der Ingenieurstudent im Prüfungskreis dann verteidigen. Die Prüfung dauert drei Tage und ist öffentlich.
Ingenieur
Ein Ingenieursanwärter wird dann ein Ingenieur wenn er drei Workshops geleitet hat und so drei vorgegebene Aufgaben eigenständig unter Aufsicht eines Betreuers erfolgreich abgeschlossen hat und für jede Teilaufgabe eine wissenschafltiche Arbeit verfasst hat. Diese wissenschaftlichen Arbeiten muss der Ingenieursanwärter im Prüfungskreis dann verteidigen. Die Prüfung dauert ebenfalls drei Tage und ist öffentlich.
Meister-Ingenieur
Ein Ingenieur wird dann ein Meister-Ingenieur, wenn er eigenständig ein gemeinnütziges Vorhaben ins Leben ruft und über Selbstfinianzierung ohne Startkapital und Kredite wachsen läßt und dieses Vorhaben so erfolgreich vollendet. Er muss beweisen, dass er Dinge ins Leben rufen kann. Über das gemeinnützige Vorhaben muss der Ingenieur dann eine wissenschafltiche Arbeit verfassen. Diese wissenschaftlichen Arbeiten muss der Ingenieur im Prüfungskreis dann verteidigen. Die Prüfung dauert ebenfalls drei Tage und ist öffentlich.
Der Prüfungskreis
Der selbstorganisierende Prüfungskreis setzt sich aus fünf Fachleuten mit mehrjähriger Berufserfahrung und einem Mindestalter von 35 Jahren zusammen, wobei einer der Mitglieder des Prüfungskreises der Mentor des Prüfungsanwärters ist. Der Mentor des Prüfungsanwärters holt sich aus seinem Bekanntenkreis fünf Fachkollegen in den Prüfungskreis. Die Mitglieder des Prüfungskreises bürgen für den Abschluss des Prüflings. Die Öffentlichkeit hat die Aufgabe, Zeuge der Prüfung zu sein und die Echtheit der Prüfungszeugnisse entweder zu bestätigen oder abzulehnen.
Tags: Bildung, Studium, Universität